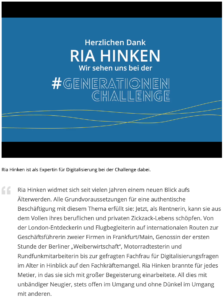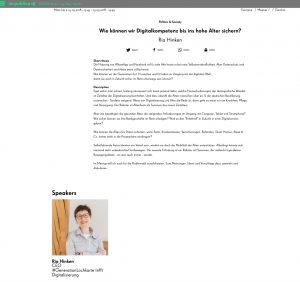Mathematische Modelle tragen dazu bei, Meinungsbildung und Polarisierung in sozialen Medien zu visualisieren und zu verstehen
Wie sich in sozialen Medien Meinungen bilden und inwiefern es dabei zu einer zunehmenden Polarisierung der Standpunkte kommt, untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs europäischen Ländern im Projekt Odycceus (kurz für Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Space), das die Europäische Kommission im Rahmen des Future Emerging Technologies-Programms (FET) fördert. Wir sprachen mit Eckehard Olbrich und Sven Banisch, die seitens des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften an dem Forschungsvorhaben beteiligt sind, über die Ziele des Projekts, die Möglichkeiten, gesellschaftliche Prozesse mithilfe mathematischer Methoden und künstlicher Intelligenz zu analysieren, und die Schwierigkeiten, denen sie sich dabei stellen müssen
Herr Dr. Olbrich, Herr Dr. Banisch, welche Ziele verfolgen Sie und Ihre Koopertionspartner im Odycceus-Projekt?
Olbrich: Die Ausgangslage für das Projekt war, dass der Umfang und die Geschwindigkeit der Kommunikation von Meinungen durch die Digitalisierung und die sozialen Medien immens zugenommen haben und dass es für einen einzelnen Menschen nicht mehr möglich ist, damit umzugehen. Im Odycceus-Projekt entwickeln wir Werkzeuge, also mathematische Methoden, Algorithmen und Software unter anderem auf Basis des maschinellen Lernens, um diese Kommunikation beobachtbar und handhabbar zu machen, und zwar für Wissenschaftler und professionelle Beobachter wie Journalisten oder Politiker, aber auch für den einzelnen, politisch interessieren Bürger. Unser Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf der politischen Kommunikation. Und eines unserer speziellen Themen sind die kulturellen Konflikte, die es heute vor allem in vielen westlichen Gesellschaften zwischen politischen Lagern gibt. Die Dynamik hinter diesen Konflikten versuchen wir zu verstehen.
Welche Instrumente entwickeln Sie zu diesem Zweck?
Banisch: Da unterscheiden wir zwischen empirischer Arbeit und theoretischer Modellierung. Auf der empirischen Seite haben wir einiges mit Twitter gemacht. Vor allem haben wir die Retweet- mit den Reply-Strukturen verglichen, also analysiert, in welchen Strukturen Information geteilt wird und in welchen Strukturen eher Konfrontation stattfindet.
Was machen Sie da konkret?
Olbrich: Zunächst gibt es bei uns am Institut auch jenseits des Odycceus-Projekts einige Kollegen um Jürgen Jost, die neue mathematische Instrumente zur Netzwerkanalyse entwickeln. Mit solchen Instrumenten haben wir in einer Gruppe von relevanten Akteuren wie etwa Politikern und Journalisten systematisch analysiert, wie oft und von wem Tweets geteilt wurden und welche Struktur das Retweet-Netzwerk hat. Da sehen wir auf der einen Seite einen Cluster der AfD, auf der anderen Seite einen Cluster von SPD, Grünen, Linken und vielen Medien und in der Mitte die CDU und die Freien Wähler. Dann haben wir uns die Struktur des Netzwerks angeguckt, in dem Tweets beantwortet werden. Zwischen beiden Netzwerken haben wir eine Asymmetrie gefunden: Im Retweet-Netzwerk ist das Mainstream-Cluster zwar größer als das Cluster der Rechtspopulisten, aber die sind viel aktiver darin Antworten zu schreiben.

am Max-Planck-Institut für Mathematik in den
Naturwissenschaften und koordiniert das Odycceus-Projekt.
© privat
Worin liegen da die mathematischen Herausforderungen? Kann man nicht einfach abzählen, welcher Tweet wie oft geteilt und beantwortet wird?
Olbrich: Die mathematische Herausforderung besteht darin, das richtige Maß zu finden, damit man das misst, was man wirklich messen will. Denn wenn ich nur zähle, habe ich eine Zahl, aber womit vergleiche ich diese Zahl? Eine Aussage, dass etwa die Mitglieder des rechtspopulistischen Clusters aktiver sind, wissenschaftlich sauber zu treffen, ist nicht trivial. Dafür konstruiert man erst einmal das Modell eines Netzwerks, in dem die Struktur rein zufällig entsteht. Das muss man dann formalisieren und versucht dann, die Abweichung davon zu messen.
Kann ich mir als Nutzer die Strukturen der Netzwerke, in denen ich aktiv bin, irgendwo vor Augen führen?
Olbrich: Damit sich Nutzer schnell einen Überblick verschaffen können, haben wir den Twitter Explorer entwickelt. Da kann ich ein Schlagwort eingeben, die App sammelt dann die Tweets zu diesem Thema und stellt das Retweet-Netzwerk grafisch dar. Darin kann ich sehen, welche Nutzer die meisten Followern haben, von welchen Nutzern die Tweets am häufigsten retweetet wurden und welche Tweets das sind. Darüber hinaus kann ich mir im Hashtag-Netzwerk auch noch anschauen, um welche Inhalte es geht. Gerade arbeiten wir daran, auch die Struktur von Reply-Netzwerken sichtbar zu machen.
Neben den Twitter Analysen machen Sie aber noch viele andere Dinge. Könnten Sie darüber einen kurzen Überblick geben?
Banisch: Auf der empirischen Seite arbeiten wir auch mit Methoden der semantischen Textanalyse, also der Analyse von Bedeutungszusammenhängen. Auf Seite der Modelle gibt es komplementär dazu zwei Ansätze, zum einen Modellierungen zu der Frage, wie sich Reaktionen aus dem sozialen Umfeld auf die Meinungsbildung und Meinungsäußerung auswirken und zum anderen Modelle, die anhand der Argumente in einer Debatte die semantischen Dimension ausloten. Und schließlich bringen wir die Modellierungen und die Empirie zusammen, indem wir in Experimenten die Effekte und Mechanismen testen, die wir mit den Modellen beschrieben haben, und zwar wiederum zu den sozialen Feedback-Mechanismen und zu den Inhalten.
Die semantischen Dimensionen einer Debatte auszuloten, klingt sehr abstrakt…
Olbrich: Das ist aber ein wichtiger Punkt, weil er deutlich macht, was wir unter kulturellen Differenzen verstehen: In vielen Diskussionen argumentieren die unterschiedlichen Seiten entlang unterschiedlicher Dimensionen. Das kann man bei der Klimadebatte, im Moment aber vielleicht noch offensichtlicher bei der Coronadebatte beobachten: Diejenigen, die für Lockerungen votieren, präferieren die ökonomische Dimension, und die dafür argumentieren, die Einschränkungen aufrechtzuerhalten oder sogar zu verstärken, stellen die gesundheitliche oder epidemiologische Dimension in den Vordergrund. Das sehen wir schon mit den Mitteln, die wir jetzt haben, wollen das aber künftig mit Modellen noch stärker herausarbeiten.
![Sven Banisch forscht am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften auf dem Gebiet der rechnergestützten Sozialwissenschaften und unter anderem zu Meinungsdynamiken.
[weniger] © privat](https://konzepte-online.de/wp-content/uploads/2021/02/original-1612865722-1-300x289.jpg)
anderem zu Meinungsdynamiken.
© privat
Welche Ziele verfolgen Sie mit den Modellierungen?
Banisch: Wir wollen die Dynamik, wie sich Meinungen entwickeln, mithilfe der Modelle besser verstehen. Das kann bedeuten, mit Modellen so nah wie möglich an empirische Befunde zu kommen. Das kann aber auch bedeuten, an den Annahmen so zu arbeiten, dass sie der Wissensgrundlage anderer Disziplinen entsprechen und zum Beispiel auch psychologische Mechanismen einbeziehen. Die Modelle bilden also ein theoretisches Bindeglied zwischen den Befunden der empirischen Sozialforschung und sozialen Theorien, aber auch anderen Disziplinen wie der Psychologie. Modelle helfen auf diese Weise, Theorie zu entwickeln. Indem wir in den Modellen verschiedene Annahmen zu den psychologischen und sozialen Mechanismen hinter der Meinungsbildung in Gesellschaften machen, können wir untersuchen, welche Mechanismen da tatsächlich zusammenspielen.
Wie gut geben die Modelle die Wirklichkeit wieder?
Olbrich: Viele der Meinungsdynamik-Modelle arbeiten nur mit einer binären Meinung. Es gibt also nur Pro und Contra, oder bei kontinuierlichen Meinungen eine eindimensionale Verteilung zwischen voller Zustimmung und voller Ablehnung. Wenn es dann eine soziale Interaktion gibt, gucken wir, wie sich dadurch die Meinung zu einem Thema verändert. Wir haben dagegen untersucht, wie sich Meinungen zu verschiedenen Themen abhängig von der politischen Grundeinstellung entwickeln. In einer Untersuchung der politischen Situation in den USA hat auch das PEW Research Center gezeigt, dass sich die Meinungen zu unterschiedlichen Themen immer stärker ideologisch an den Positionen entweder der Demokraten oder der Republikaner ausrichten. Dieses Phänomen können wir mit einem Modell, das die Argumente der verschiedenen Akteure analysiert, wiedergeben. Wir erhalten so empirisch informierte Modelle der Meinungsdynamik. Wir wollen die abstrakten Modelle, die meist aus der Physik kommen, also näher an die empirische Realität führen und gleichzeitig die empirische Realität messen, um deren Abbildung zu verbessern. Wir bohren gewissermaßen von zwei Seiten und hoffen, dass wir uns dann auch an der richtigen Stelle treffen.
Banisch: Bislang zielen Modelle zudem eher auf generelle Phänomene wie etwa die Polarisierung von Meinungen ab. Solche abstrakten Phänomene können sich in jedem spezifischen Fall aber ein bisschen anders äußern. Auf der abstrakten Ebene sind die Modelle schon sehr gut, aber sie sind noch nicht so gut darin, die Spezifik eines bestimmten Falls wiederzugeben. Das wollen wir ändern.
Für welche speziellen Prozesse entwickeln Sie Modelle?
Banisch: Wir können mit einem Modell zum Beispiel nachzuvollziehen, wie sich manche Minderheiten in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen und welche Rolle dabei soziale Medien spielen. Dabei bilden wir zum einen die inhaltlichen Dimensionen ab und analysieren zum anderen die Rolle des sozialen Feedbacks im Netzwerk. Künftig möchte ich diese beiden Modelle zusammenbringen. Dass sie zusammengehören, sieht man gerade an unserer Arbeit zum sozialen Feedback sehr gut. Da haben wir uns angeschaut, wie rein bestätigende und ablehnende Äußerungen von der Peer Group, vom sozialen Umfeld, die innere Überzeugung beeinflussen. Solche Äußerungen sind zum Beispiel Likes oder Retweets und Kommentare ohne inhaltliche Argumente wie etwa „Ja, genau richtig!“ oder „Das geht doch gar nicht, das kann man doch nicht sagen!“. Wir haben darüber hinaus untersucht, wie die Erwartung, mit einer Äußerung eher auf Zustimmung oder Ablehnung zu stoßen, die Bereitschaft beeinflusst, sich überhaupt zu äußern. Um die Meinungen zu analysieren, müssen wir auf die Inhalte schauen. Die Frage, ob jemand seine Meinung in einem bestimmten Umfeld äußert oder nicht, ist dagegen durchaus eine strukturelle Frage.
Zu welchen Ergebnissen kommen Sie bei Ihren Untersuchungen zum sozialen Feedback?
Olbrich: Das Modell gibt sehr schön wieder, dass ich mich eher äußere, wenn ich Bestätigung erwarten kann. So kann es zu der Schweigespirale kommen, weil eine laute Minderheit, die sehr aktiv ist und geschlossen auftritt, die leise Mehrheit zum Schweigen bringen kann.
Banisch: Wir werten gerade auch ein Experiment aus, das wir zusammen mit Leipziger Soziologen gemacht haben, um unser Modell zu testen. Darin haben wir Probanden befragt, ob der Mensch über anderen Tieren steht, und dann geschaut, wie Ablehnung und Zustimmung die Meinung dazu beeinflussen. Wir sehen dabei, dass gemischtes Feedback die Meinung am stärksten beeinflusst. Das haben wir so nicht erwartet. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass ein Reflexionsprozess in Gang gesetzt wird, wenn es aus dem sozialen Umfeld kein eindeutiges Feedback gibt. Wir sind aber gerade noch am Puzzeln, wie das zum jetzigen Modell passt. Aber die Idee hinter unserem Ansatz ist ja auch, dass wir ein Phänomen anhand einer Theorie modellieren, und dann die soziologischen und psychologischen Annahmen, die im Modell stecken, so anpassen, dass wir die empirischen Daten aus Experimenten wiedergeben können. In einem anderen Experiment erklärt das Modell schon sehr gut die Ergebnisse.
Worum geht es in diesem Experiment?
Banisch: Das bezieht sich auf das Modell, mit dem wir Argumente in einer Debatte analysieren. Das Forschungszentrum Jülich hat in einem Kooperationsprojekt ein Expertenpanel eingerichtet, das Argumente für und gegen Energie aus Kohle, Gas, Solar, Wind onshore und offshore und Biomasse identifiziert hat. Dann mussten Leuten bewerten, wie überzeugend sie die Argumente finden. Dabei hat sich ergeben, dass Menschen Argumente abhängig von der Stärke ihrer Einstellung umso positiver bewertet haben, je mehr die Aussagen ihrer Einstellung entsprechen. Mit dem Argumenten-Modell können wir diese experimentellen Befunde direkt in ein Modell integrieren, mit dem wir analysieren, wie sich die selektive Informationsverarbeitung auf die Meinungsbildung in einer Gruppe auswirkt. Bei den Themen Gas und Biomasse beobachten wir eine geringere Voreingenommenheit dafür oder dagegen. Daher können wir bei diesen Themen eher erwarten, dass sich die Gruppe schnell auf eine Meinung einigt. Bei Themen wie Kohle und Wind, zu denen es vorher schon eine größere Voreingenommenheit gibt, kommt es in einer Gruppe dagegen mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einer weiteren Polarisierung.
Hass im Netz
Bereits jeder fünfte Internet-Nutzer ist schon einmal Opfer von Hate Speech geworden. Können wir etwas gegen Hasskommentare tun? Und welche Strafen müssen Verfasser befürchten? Im neuen Wissen Was – Video geben Max-Planck-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Antworten. Das Video finden Sie auf YouTube. Wir können den Link aus Gründer der DSGVO hier nicht einbinden. Mit KI und Algorithmen gegen Hass im Netz | Hasskommentare und Meinungsfreiheit | Wissen Was
Wie können Ihre Methoden und die Beobachtungen, die Sie damit machen, helfen, den Prozess der Meinungsbildung zu versachlichen und der Polarisierung in der Gesellschaft entgegenzuwirken?
Banisch: Wenn Menschen sich in den sozialen Medien oder auch auf tageschau.de informieren, sind Kommentare für viele heute eine wichtige Quelle. Da kommen Leute, die auf die Mainstream-Medien schimpfen, mit solchen zusammen, die das nicht tun. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, welche Gruppen sich dort äußern, und zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist, diese Meinungsäußerungen in meine Meinungsbildung einzubeziehen. Vielleicht versuchen manche Gruppen dort auch strategisch, die Meinungshoheit zu erreichen. Das versuchen wir zum Beispiel mit dem Modell, wie soziales Feedback den Willen zur Meinungsäußerung beeinflusst, offenzulegen.
Olbrich: In Bezug auf die kulturellen Differenzen verfolgen wir auch die Idee, die unterschiedlichen Weltsichten für die jeweils andere Seite sichtbar zu machen. Es ist ja ein psychologischer Fakt, dass man sehr viel leichter Argumente für die eigene als die gegnerische Position findet. Das gerade auf einer abstrakten Ebene zum Beispiel in Form der kausalen Argumente sichtbar zu machen, kann vielleicht helfen die Debatte zu erleichtern.
Aber kann alleine die Offenlegung von Netzwerkstrukturen und Argumenten, die ja oft ohnehin schon auf dem Tisch liegen, die Debatte befördern?
Olbrich: Die Argumente mögen zwar im Prinzip auf dem Tisch liegen, sind aber nicht für alle gleichermaßen sichtbar, auch wegen des Volumens und der Geschwindigkeit digitaler Kommunikation. Letztlich wissen wir jedoch noch nicht, ob es die Debatten verbessern wird, wenn wir sie sichtbar machen. Das herauszufinden, ist auch Teil unserer Arbeit.
Wo liegen die Grenzen vor allem der Modellierungen von Meinungsbildung zu strittigen Themen. Werden Modelle solche gesellschaftlichen Prozesse irgendwann in allen Facetten erfassen?
Olbrich: Meiner Meinung nach ist da noch Luft nach oben. Ich denke, wir können mit den Modellen noch sehr viel näher an die Wirklichkeit herankommen.
Banisch: Wenn wir Modelle jedoch nutzen, um Theorien zu entwickeln, ist das vielleicht auch nicht so entscheidend.
Olbrich: Ich sehe allerdings zwei Probleme, wenn die Modelle irgendwann tatsächlich immer näher an die Wirklichkeit herankommen. Zum einen stellt sich dann die Frage, wie Menschen damit umgehen, dass sie dabei mitmodelliert werden. Wir wollen die Modelle ja vielleicht nutzen, um die Art und Weise, wie Diskurse in sozialen Medien geführt werden, zu verbessern. Aber Menschen haben schon im Zusammenhang mit Nudging, bei dem man das Verhalten von Personen in eine bestimmte Richtung stupst, Angst manipuliert zu werden.
Im Sinne einer transparenten, demokratischen Debatte müssen wir jedenfalls offenlegen, was die Modelle machen. Dann können die Nutzer sich natürlich auch bewusst anders verhalten, als vom Modell angenommen, wenn sie merken, dass etwa eine App sie mit einer Nutzer-Schnittstelle in eine bestimmte Richtung stupsen will. Das kann man natürlich wieder versuchen mitzumodellieren. Zum anderen können Modelle auch die Wirklichkeit beeinflussen. Wenn wir anhand der Modelle eine Plattform programmieren, die einen besonders fairen und sachlichen Austausch ermöglicht, könnte es sein, dass die Leute sich so verhalten, wie es das Modell beschreibt.
Es gibt dafür ein historisches Beispiel aus dem Derivatenhandel. Damals haben sich Anleger bei der Festsetzung an einem Modell, Black-Scholes Formel, orientiert, das aus rein rationalen Prinzipien abgeleitet war. Zunächst waren die Aussagen des Modells empirisch falsch. In dem Maß, in dem es benutzt wurde, wurde die Formel dann aber immer richtiger. Das ging solange gut, bis es zu einem Crash kam. Wie wir mit solchen Folgen unserer Arbeit umgehen, sind meiner Meinung nach Fragen, die wir jetzt debattieren müssen. Wir als Wissenschaftler können jedenfalls irgendwann nicht mehr sagen, wir machen hier im Elfenbeinturm mal Wissenschaft und modellieren mal. Die Betroffen müssen dann auch mitreden können.
Das Interview führte Peter Hergersberg.





 Facebook
Facebook